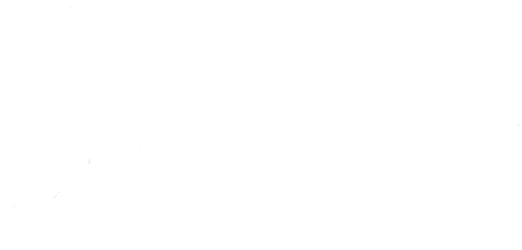(aus: Ordenskorrespondenz 2/2017)
Autorin: Dagmar Doko Waskönig
Eine Grundlage: das Hingezogen-Werden zu religiösem Erfahren
Viele Christen mag es noch heute verwundern, dass eine hier im Westen aufgewachsene Frau den Weg zur buddhistischen Nonne gegangen ist. Damit es dazu kommen konnte, sind freilich, so scheint mir, mehrere Bedingungen zusammen gekommen. Im Rückblick auf diese Entwicklung ist zunächst ein auffallend früh, nämlich bereits mit vier Jahren gespürtes Hingezogen Werden zu einem religiösen Erleben zu erwähnen. Von da an ging ich wie selbstverständlich jeden Sonntag zum Kindergottesdienst, bis zur Schulzeit sogar allein. Dies scheint auch in sofern bemerkenswert, als meine Eltern keine Kirchgänger waren und ich nicht einmal getauft war.
Erst in den Jahren, als ich in der Oberstufe war und mich mit dem Krieg und Holocaust befasste, kamen ernsthafte Zweifel am Wirken Gottes, so wie es mir vermittelt wurde. Jene unglaublichen Geschehnisse, das maßlose Leiden der Menschen konnte ich mit der Vorstellung eines eingreifenden Gottes nicht zusammen bringen. Einige Jahre später, als ich einundzwanzig Jahre alt war, kam ein starkes persönliches Leiden hinzu: der Tod meiner Mutter. Mit einem Male verlor ich den Gottesglauben. Doch überdauerte offensichtlich eine religiöse Disposition die nachfolgenden Jahre, obwohl ich nicht mehr zur Kirche ging. Während meines Kunstgeschichts-Studiums erlebte ich bestimmte Objekte der sakralen Kunst des Frühmittelalters geradezu wie eine Art Offenbarung des Heiligen.
Der stark werdende Druck, der bekanntlich auf meiner Generation lastete, führte auch mich Ende der 60er Jahre erst einmal zur radikalen, marxistisch fundierten Gesellschaftskritik. Kritische Analysen bezogen sich bald auch auf die Institutionen der christlichen Kirchen, ihre Rollen in der Geschichte und Gegenwart. Anfang der 70er Jahre entschloss ich mich zum Kirchenaustritt.
Nach einigen Jahren des politischen Engagements machte sich erneut ein Hingezogen-Werden zu spirituellen Erfahrungen bemerkbar. In der Phase der sich erschöpfenden linken Diskussionen kam ein Gefühl des Unbefriedigt-Seins mit meiner beruflichen Situation hinzu. Infolge der mit meiner damaligen Ehe zusammenhängenden Übersiedlung nach Hannover hatte ich, da es dort nicht anders möglich schien, eine wissenschaftliche Richtung eingeschlagen, die ich nicht wirklich gern weiterverfolgen mochte.
Parallel dazu hatte ich – damals im Alter von Mitte Dreißig – Verbindung zu etwas für mich zuvor ganz Unbekanntem aufgenommen. Infolge eines Bandscheibenschadens war mir Yoga empfohlen worden, so dass ich ein wenig mit östlichen Weisheiten in Verbindung kam. Bald fand ich den Weg zur Zen-Meditation, übte zunächst allein Zazen und wurde dann 1982 Mitbegründerin der ersten Zen-Gruppe in Hannover. Eine neue Dimension des wohltuenden Erfahrens von Körper und Herz/Geist hatte sich aufgetan.
Ein bedeutsamer Schritt: die Ordination zur Zen-Nonne
Von Anfang an übte ich Soto-Zen in der Tradition, die Meister Deshimaru nach Europa übermittelt hatte, und mein Wunsch, diese Praxis zu intensivieren, führte mich 1983 nach Italien, wo einer seiner Schüler, Meister Taiten Guareschi, ein großes internationales Sesshin organisierte: neun Tage intensive Zen-Praxis mit den dazu gehörigen Elementen der Lehre, der Arbeit mit den Händen (Samu) und den rituellen Teilen des Tagesablaufs. Diese yogische, Körper und Herz/Geist einbeziehende Sammlung entsprach mir unmittelbar.
In Stichworten, angedeutet: Die Übung der Versenkung bei körperlicher Zentrierung, die Kraft der Haltung im Lotossitz, der Weg zu einer inneren Ausgewogenheit, dazu ein einfacher Lebensstil, realisiert in Disziplin, Sorgfalt und nicht zuletzt mit einer feinen, japanisch inspirierten Schönheit, das Leben in einer Übungsgemeinschaft bei strikt eingehaltenem Tagesablauf – all dies erfuhr ich als einen Übungsweg, der das eigene Befinden sogleich spürbar veränderte, ja, als Glück. Es wäre müßig zu versuchen, dies präziser in Worte zu fassen. Durch Zazen waren mir zudem recht bald weitgehende Wahrheitserfahrungen zuteil geworden. Und die Buddha-Lehre, unter anderem die Lehre vom Karma, wiesen mir einen einleuchtenden Weg zur Sicht auf die unvollkommene Welt, in der so viel Leid erzeugt und erlebt wird.
Die Atmosphäre lichter geistiger Weite und Tiefe, die Ausstrahlung und das Verhalten der in Italien teilnehmenden Mönche und Nonnen überzeugte mich, so dass nach wenigen Jahren der Wunsch da war, selbst die Ordination zur Zen-Nonne zu erhalten. Anfang 1986 ging ich diese tiefere Verpflichtung gegenüber den Gelöbnissen für die entsprechende Lebensführung ein. Innerlich hatte ich mich zuvor durchaus mit dem Thema der Entsagung hinsichtlich einer ungebunden weltlichen Orientierung des Lebens befasst. Freilich war dies noch keine stark einschneidende Entscheidung, denn zum einen gibt es in der japanischen ZenTradition seit dem späten 19. Jahrhundert kein Zölibat mehr. Überdies hatte es in Japan bereits seit dem 9. Jahrhundert eine eigene Entwicklung in Bezug
auf das Ordensrecht gegeben, eine Abkopplung von der überkommenen Ordensdisziplin mit den sehr ins Detail gehenden, zahlreichen Vorschriften (Pratimoksa).
Nun fuhr ich immer öfter ins Zen-Kloster nach Italien, wo ich mich in der im Soto-Zen betonten Praxis des Flickengewandes (Jap. Kesa, Skt. Kasaya), das wir selbst per Hand nähen, und der Essschalen schulen konnte. Beide Dinge werden bei der Ordination übergeben. Später durfte ich zudem die verschiedenen Tempeldienste erlernen, konnte dann auch deutlicher durchschauen, wie wir an den diversen Instrumenten den Tag durch die Klänge strukturierten. Da ich recht musikalisch bin, machte mir auch dies viel Freude.
Ende der 80er Jahre initiierte Meister Taiten erstmals ein Studienprogramm, an dem ich ebenfalls begeistert teilnahm. Seit Anfang der 90er Jahre war ich dort dann als Direktorin des Studiums und selbst lehrend tätig und erhielt bald auch eine Lehrautorisierung. Durch das Studium der Lehre und Geschichte des Buddhismus sowie meine Aufgaben in der Deutschen Buddhistischen Union (DBU) wuchs zudem mein Interesse daran, auch die anderen Hauptschulen des Buddhismus eingehender kennen zu lernen. Außerdem studierte ich an der Universität Göttingen Sanskrit und Pali, die Basissprachen für die buddhistischen Texte.
Die hohe Ordination zur Bhiksuni im Jahre 2005 in Hannover, wo ich das Zen Dojo Shobogendo leite, war 1991 die Pagode Vien Giac, das Zentrum der vietnamesischen Buddhisten in Deutschland, eröffnet worden. Da ich in der Nähe der Pagode wohne, entwickelte sich bald auch eine Verbindung dorthin. Im Laufe der folgenden Jahre hatte der Gründerabt, der Hochehrw. Thich Nhu Dien, mich nach und nach in viele Dinge einbezogen, die für die Ordensleute üblich sind. Schließlich durfte ich sogar, obwohl ich die hohe Ordination noch nicht hatte, während der DreimonatsKlausur am Ritual des Mittagessens und der anschließenden Prozession und Hauptliturgie des Tages in der großen Halle teilnehmen – durchaus zum Missfallen einer der alten Nonnen.
So reifte schließlich der Wunsch in mir, die international gültige hohe Ordination zur Bhiksuni zu erhalten. Dazu plante ich, nach Taiwan zu fliegen, doch der „Zufall“ wollte es, dass diese seltenere große Doppelordination für Mönche und Nonnen just in jenem Jahr in Hannover stattfinden sollte. Im Juli 2005 erhielt ich dort die Weihe zur Bhiksuni mit den zahlreichen, traditionellen Gelöbnissen, wozu nun auch der Zölibat gehört. Die aufwändige Zeremonie hat sich ebenso wie die Ordination zur ZenNonne und auch die sogenannte Dharma-Übertragung, die ich Anfang 2003 in Japan von Gudo W. Nishijima Roshierhielt, tief in mir eingeprägt.
Buddhistische Nonne in Deutschland: eine Pioniersituation
Weiterhin blieb ich in meiner kleinen Wohnung wohnen, denn die vietnamesische Praxis der Reines Land-Schule unterscheidet sich sehr von meinem Zen-Weg. Im buddhistischen Orden, den der Buddha als Wanderorden gegründet hat, gibt es keine Verpflichtung, in einem Kloster zu leben, auch nicht die stabilitas loci. Indessen gehe ich weiterhin täglich, sofern es meine Lehrtätigkeiten zulassen, zum Mittagstisch der Ordinierten in die Pagode, nehme an den großen Festen teil und vor allem an wesentlichen Praktiken der Dreimonats-Klausur, die für Ordinierte obligatorisch sind. So bin ich froh, eine solche Anbindung an ein nahe liegendes Kloster und insbesondere die Unterstützung des Gründerabtes zu haben.
Nur einige wenige deutsche Ordensleute können hier zu Lande in einem für sie geeigneten Kloster leben, denn es gibt zwar sehr viele buddhistische Zentren, aber nur wenige Klöster. Wenn künftig weitere Klöster gegründet werden, kann es nicht darum gehen, die Strukturen der asiatischen Klöster möglichst genau zu übernehmen. Der frische Blick auf die Lehre und Praxis des Buddha-Weges, auf den man sich hier so gern beruft, sollte es ermöglichen, angemessene, wohl bedachte Wege zu beschreiten.
Das Ziel mag ein gemeinschaftliches Wohnen sein, das günstige Bedingungen für die Kernaufgaben eines Klosters bereit stellt. Die Lehre und die Praxis in der Meditation und im Handeln gilt es zu bewahren, diesen Weg der Läuterung des Geistes, der die Geistesgifte Gier, Hass und Verblendung mehr und mehr überwinden hilft – ein befreiender Weg, auf dem Güte, Mitgefühl und Weisheit und transzendentes Wissen zu entfalten sind. Dann können interessierte Laien Vertrauen zu dieser Lehre und zu den diese lebenden und vermittelnden Ordinierten entwickeln, so dass ihnen eine unschätzbare Hilfe bei der Bewältigung der komplexen gegenwärtigen Lebensweise zukommen kann.
Doch ist dies weithin noch Zukunftsmusik. Umso wichtiger ist gegenwärtig die Vernetzung, der vertrauensvolle Austausch unter den deutschsprachigen Mönchen und Nonnen. Weitsichtig hatte der Hochehrw. Thich Nhu Dien bereits Anfang dieses Jahrtausends angeregt, neben der Deutschen Buddhistischen Union (DBU), die eine Laienorganisation ist, zusätzlich eine Vereinigung der Ordinierten zu schaffen. Erste Treffen, an denen Mönche und Nonnen verschiedener buddhistischer Schulen teilnahmen, führten bald zu einer Vereinsgründung, die den Namen Deutsche Buddhistische Ordensgemeinschaft (DBO) erhielt und mit der DBU zusammen arbeitet.
Die DBO ist ein Forum geworden, das zweimal im Jahr ein mehrtägiges Treffen anberaumt. Dort ist Gelegenheit, sich über die je eigene Lebenssituation auszutauschen, über die spezifischen Schwierigkeiten, die sich für Ordinierte hier ergeben. Dazu gibt es regelmäßig Schulungen in Ordensfragen sowie eine gemeinsame Meditationspraxis, ggf. auch Beratungen über auftretende Probleme mit Ordinierten. Nicht zuletzt sind wir Ansprechpartner für die Öffentlichkeit sowie für Menschen, die sich für das Ordensleben interessieren.
Mit den Nonnen in Schneverdingen in der Lüneburger Heide, vor allem mit jenen, die das Nonnenkloster Shide gegründet haben, das künftig weiter ausgebaut werden soll, bin ich in gutem freundschaftlichen Kontakt. Zur Zeit führen wir einmal wöchentlich per Skype eine Konferenz durch, während der wir uns eingehender mit den einzelnen Gelöbnissen befassen, den Hintergründen für ihre Einsetzung und die Anwendung. Des öfteren fahre ich dorthin, und wir führen gemeinsam die obligatorische Rezitation der Gelöbnisse (Pratimoksa) durch – eine zweimal im Monat zu praktizierende Erinnerung und Festigung der eingegangenen Verpflichtung.
Die Gelöbnisse für buddhistische Ordensleute sind recht zahlreich: die hochordinierten Mönche (Bhiksus) haben über 200, die Nonnen (Bhiksunis) mehr als 300 Punkte zu beachten. Viele der weniger wichtigen Dinge betreffen allerdings Verhaltensformen, die mir zuvor schon als gutes Verhalten vertraut waren. Es wird eine Aussage des Buddha überliefert, die minder wichtigen Vorschriften könnten später unter geänderten Bedingungen auch verändert werden. Doch wissen wir leider nicht mit Bestimmtheit, welche das sein könnten. Infolge dessen gibt es einige wenige Ordinierte, die auf einer wörtlichen Auslegung bestehen, während die übrigen dies nicht tun mögen. Da nicht daran zu denken ist, zu einer Einigung über nicht mehr anzunehmende Vorschriften zu kommen, geht man dann davon aus, sie stillschweigend nicht mehr zu befolgen.
Zwei Beispiele mögen für die kontroversen Auffassungen stehen. Speziell für Nonnen gibt es eine Reihe von Vorschriften, die offensichtlich ihrem Schutz dienen sollten. So dürfen sie z.B. nicht allein reisen. Viele der westlichen Nonnen tun dies jedoch, zumal sie – anders als zu Buddhas Zeiten – mitunter wie auch ich an vielen weit entfernten Orten Lehraufgaben wahrnehmen. Diese Funktion wird dann als bedeutsamer als die wörtliche Befolgung der Vorschrift angesehen, zumal wir hier und heute nicht den gleichen Gefahren ausgesetzt sind, die es im alten Indien wohl gegeben hat.
Sowohl Nonnen wie auch Mönche betrifft ein weiterer immer wieder diskutierter Aspekt. Sie dürfen – so heißt es – kein Geld annehmen. Befugte Laien übernehmen dann die damit einhergehenden Aufgaben. Dies wird im Vinaya, den Schriften zur Ordensdisziplin, detailliert geregelt. Doch nur sehr wenige Ordinierte halten sich an diese Vorschrift. Die meisten der hiesigen Ordensleute ziehen es vor, den damit einhergehenden Umständen auszuweichen und abzuwägen, was wichtiger ist: das, was sie erledigen oder ohne Komplikationen durchführen wollen oder die strikte Einhaltung der Vorschrift. Man vergegenwärtige sich beispielsweise die Situation, wenn jemand mit der Bahn
zu einer Konferenz reisen möchte. Ein Laienanhänger würde die Fahrkarte besorgen, am Zielbahnhof müsste wieder jemand da sein, der eventuell eine Busfahrkarte besorgt, falls man allein reisen würde. Natürlich sei eingestanden, dass ein höherer Grad von Entsagung im Spiel ist, wenn man gänzlich darauf verzichtet, sich mit Gelddingen zu befassen.
Insgesamt gesehen bin ich durchaus zufrieden mit meiner Situation, wenn auch wie bei etlichen anderen Nonnen der Wunsch, doch in einer passenden Gemeinschaft zu leben, immer mal wieder da ist. Das enorm asketische Leben im Zen-Kloster, die Zazen-Praxis in Stille und die zahlreichen Aktivitäten für die Gemeinschaft, hatten durchaus eine segensreiche Wirkung auf mich. Ein Gesammelt-Sein von Körper und Geist mit dem Geschmack der strahlenden Klarheit – kraftvoll und subtil zugleich – ein Tun des Wesentlichen in jedem Augenblick gilt es, gegenwärtig während der Sesshins zu realisieren, die sozusagen ein „Kloster auf Zeit“ sind.
Auf Dauer möchte ich nicht in einem derart absorbierenden Zen-Kloster, wie ich es erlebt habe, leben. Die Ruhe und Zeit zum Studieren, zum Vorbereiten der Vorträge, die ich nicht missen möchte, war dort nicht gegeben. Dies war mir nur in Hannover möglich. Wir Nonnen tauschen uns in der DBO auch über die Erfahrungen aus, die wir an den früheren Orten unserer Praxis gemacht haben, um die Vorstellungen in Hinblick auf künftige Projekte zu klären.